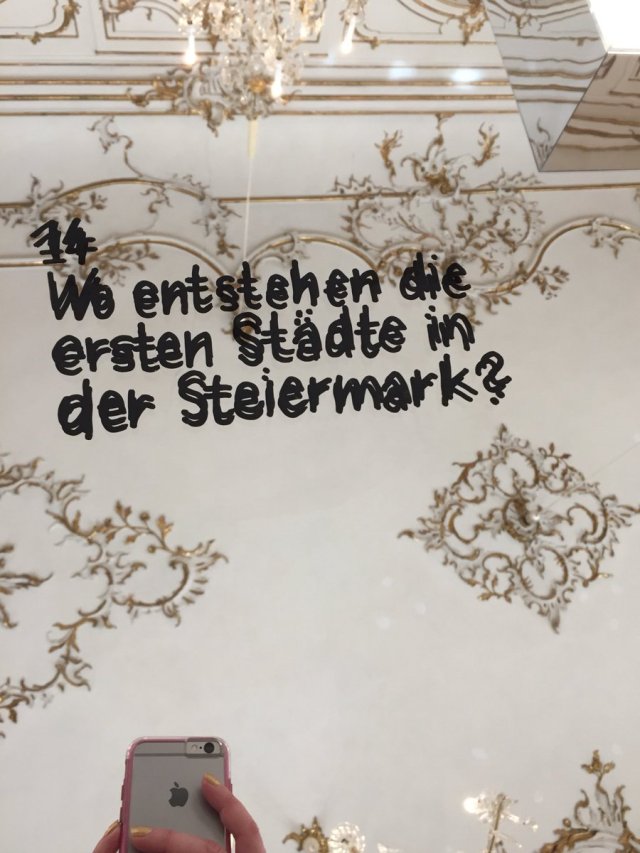Am 22. Jänner sitze ich in einem Seminar und lese auf Twitter, dass der öffentliche Verkehr in Wuhan eingestellt wird. Ich erschrecke. In der Rauchpause draußen höre ich die Straßenbahn, stelle mir vor, dass Wien abgeriegelt wird, dass nichts mehr fährt, dass Stille einkehrt. Ich kann es mir vorstellen, weil ich mir Wuhan vorstellen kann. 2009-2010 durfte ich in Wuhan ein Jahr studieren. (Die Fotos sind aus dieser Zeit.)
Die Uni liegt in Wuchang, einer von drei Stadtteilen Wuhans (die anderen zwei sind Hanyang und Hankou). Getrennt ist Wuchang von den zwei anderen Teilen durch den Yangtze (Changjiang).
In meinen Notizdokumenten, die ich nachlässig führe, sammeln sich kleine Einträge zur Stadt und zur Erinnerung.

Wuhan (Jänner 2020, Wien)
Warum schmerzt eine Stadt so? Warum fallen die leeren Straßen der Stadt im Jänner 2020 so in meinen Kopf hinein, füllen ihn mit Echos der Vergangenheit: wie sich die Zimmertür öffnet, was an den Straßenrändern zu sehen ist, wie sich die Westen der älteren Passanten zusammenfügen, die Gerüche, die Busmelodien, die Wolken, nur manchmal zu sehen. Die Türme, die eine verstreute Skyline bilden, die ein Herz bildet, einen Kaffeerand einer Erinnerung, die leuchtet und schmerzt, wenn das Wort Wuhan fällt. Wieviele Menschen kurz an mir angekommen sind, mir Essen bereitet haben, mit mir kurze Sätze ausgetauscht haben und älter geworden sind, wie ich auch.

Wuhan II (Februar 2020, Wien)
In meiner Erinnerung habe ich meine Ankunft in Wuhan im August 2009 im Tagebuch beschrieben, ich habe es aber nicht getan. In meiner Erinnerung bin ich 32 Stunden mit dem Zug aus Kunming unterwegs, in dem ich mich nur von Keksen und Bier ernährt habe und Namen bekommen habe, die ich sofort wieder vergessen habe. Ich komme an und in meiner Erinnerung sehe ich mich meinen Koffer durch die Bahnhofshalle (die Ankunftshalle unten) von Wuchang ziehen und mir war schon seit Hunan so heiß, die Temperatur im Zug stieg und stieg und ich fühlte mich elend und dreckig und verschwitzt und wollte nur schnell ins Hotel, von dem ich mir die Adresse aufgeschrieben hatte. Aber ich fand kein Taxi oder wurde nicht mitgenommen und wusste nicht, in welche Richtung irgendetwas lag und ich war fertig, mir war heiß, ich war erschöpft und allein. Und dann hat mir jemand geholfen. Hat mir ein Taxi gerufen, hat mich ins Taxi gesetzt, hat dem Taxifahrer erklärt, wo ich hinwill, ist mitgefahren und stand dann noch lang in der Hotellobby rum, weil ich vielleicht noch immer etwas brauchen hätte können. Im Hotel habe ich geduscht und dann ging es wieder, dann war ich in Wuhan. Ich habe vermutlich nicht einmal auf die Karte geschaut, wusste nur, das Hotel lag in einer Straße, die quer den Bahnhof und den Fluss verband und ich wollte unbedingt zum Fluss. Draußen war es heiß, dunstig, die Männer hatten alle ihre T-Shirts über den Bauch hochgeschoben, ein paar gingen überhaupt mit freiem Oberkörper. (Man hatte mich gewarnt, wie warm es in Wuhan sein würde.) Und in der Straße, die ich entlang laufen musste, gab es einen KFC, im KFC gab es einen Eiskaffee, ich hatte einen Eiskaffee und ich lief damit zum Fluss. Die Sonne war schon untergegangen, es war noch immer heiß und ich ging, bis ich an der Uferpromenade vom Yangtze war. Und dann staunte ich die Lichter an, die neuen Hochhäuser von Hanyang, den Fernsehturm, der eins der ersten Dinge war, die ich noch in Wien über Bilder von Wuhan lernte.
***
Der Park, in den ich einige Tage vor Weihnachten 2009 gehe und niemand ist da und alles sieht noch aus wie Herbst. Ein kleiner Pavillon steht in dem Wäldchen, auf dessen Säulen stehen Namen, Telefonnummern, Beleidigungen, Wünsche, das übliche – mit einem Kuli schreibe ich ein Wort dazu, es soll mir zehn Jahre später als kleiner Schock wieder einfallen: auf einer Säule eines Pavillons in einem kleinen, menschenverlassenen Park in Wuhan steht das deutsche Wort „Hoffnung“.
Erst Ende Jänner 2020 als ich auf Twitter die Nachricht sehe, dass jeder öffentliche Verkehr in Wuhan eingestellt wird, wird mir bewusst, wie ernst die Lage ist. Ich bin erschrocken, das Gefühl lässt nicht nach. Manchmal vergesse ich es kurz, dann fällt es mir wieder ein und ich erschrecke neu. In den vielen Nachrichten im Internet schreiben Menschen aus Wuhan, sie fühlen sich wie in einem Alptraum und das ist auch das Wort, das ich verwenden würde, wenn ich aus dem kurzen Vergessen aufwache und feststelle: es ist die Wirklichkeit, es ist der Alptraum.
Mein Jahr in Wuhan war eines der glücklichsten in meinem Leben, vielleicht weil davor so viele schlimme Dinge passiert sind und danach noch viele mehr. In Wuhan selbst habe ich nur geweint, weil ich offen war, für alles, das mir passiert und weil ich offen war, alles zu fühlen und mit allem umzugehen. Ich habe nicht geweint, weil ich unglücklich war.
Viele Sachen, die ich vom Wuhan in Quarantäne jetzt sehe, bringen konkrete Erinnerungen zurück, die ich sonst nicht aufgerufen hätte: die vielen Menschen, die sich aus den Fenstern ihrer Hochhäuser „Wuhan, Jiayou!“ zurufen erinnern mich an die Stromausfälle abends am Campus, als nicht nur unser Dorm, sondern auch der gegenüber betroffen war und alle aufschrien – noch mehr, die Fenster öffneten und brüllten, weil man sich im Dunkeln so zumindest weniger allein fühlt.
Ich habe Wuhan fast menschenleer gesehen. Abends um 12 waren manche Straßen schon leer, die Neonlichter an den Gebäuden wurden Punkt Mitternacht abgedreht. Wenn ich früh zum Bahnhof ging, vor halb 6 am Morgen, waren kaum Menschen auf der Straße. Die KöchInnen, die von früh bis spät am Eingang zum Campus frisches Essen zubereiteten, zogen ihre Utensilien Richtung Campus. Auf den Straßen wurde gekehrt, vereinzelte Taxis fuhren, die Busse waren recht leer.

Wuhan III (Februar 2020, Graz)
An die meisten Dinge in Wuhan kann ich mich erinnern, weil ich sie mir aufgeschrieben habe – zumindest kurz – oder weil es Fotos davon gab. Die meisten Fotos von Wuhan habe ich verloren, weil mein Laptop kurz nach der Rückkehr kaputt wurde und dann bei einem Wohnungseinbruch gestohlen wurde – die meisten Fotos sind weg, für immer.
Ich kann mich an Geräusche erinnern: die Alarmanlagen der Roller vor dem Studentenwohnheim, die immer bei Sturm und Unwetter losgingen. Das Geräusch meiner Zimmertür, das Piepsen der Karte, das Schleifen des angeklebten Kartons unten an der Tür, weil die Ritze zu breit war. Das Scharren in den Woks an den Essensständen beim Universitätseingang. Die Geräusche der Busse, aber vielleicht erinnere ich mich nur, weil ein japanischer Tourist ein Video davon auf Youtube hochgeladen hat, das ich mir als mp3 runtergeladen habe, um es wie einen Schatz aufzubewahren.
Woran ich mich erinnere, ohne es notiert zu haben: die Scheinwerfer von den seltenen Autos am Hügel in der Universität, die sich im Nebel abends brechen, wie strahlende Geister erscheinen. Die Plastikstreifen an den Eingängen der kleinen Supermärkte im Campus. Der Geruch vom Kuchen des Bananenkuchengeschäfts, das im zweiten Halbjahr vor der Universität aufsperrte. Die Dinge, die ich aus dem Bus sah oder in Bussen sah: einmal in einem Bus, der am Ufer des Donghus vorbeifuhr, da stand am Ufer ein Mann, zur Fahrbahn gerichtet, die Hose herunten (beide), grinsend. Oder der Clown, der mitten in einem vollgestopften Bus stand, der an mir am Gehsteig vorbeifuhr. Die vielen Roller am Gehweg, man musste rechtzeitig ausweichen. Am Qunguangguangchang die kleinen bunten Käfige mit Hundewelpen und Kaninchen. Der Fußgängerübergang weiter vorn, wo abends immer jemand Musik spielte. Die kleinen Gassen, autofrei, in die man gelangte, wenn man einmal von den Hauptstraßen abbog, die vielen Kabel, über dem Kopf gespannt, die vielen Läden und Märkte. Der Kleidermarkt in Hankou, den ich einmal unabsichtlich fand und dann suchen musste, jedes Mal vergaß ich, wie man hinkam, wie ein mystischer Ort: ich fand ihn immer nur, wenn ich recht bald, nachdem ich über Hanyang von Wuchang mit dem Bus gekommen war, ausstieg und mich dann vorsätzlich verlaufen wollte. Man hat mir dort Unterhosen verkauft, die viel zu klein für mich waren. In Hankou an der Uferpromenade kaufte ich meine ersten Lotuskerne und aß sie roh.
In Wuhan leben hieß vor allem über den Fluss fahren, mal wegen der Aufenthaltsgenehmigung, mal um Hankou zu sehen, dann, weil der Zug vom Bahnhof in Hankou fuhr statt von Wuchang (oder dort ankam), dann ins Kunstmuseum oder weil ich herausfinden wollte, auf wieviel verschiedene Arten man den Fluss überqueren konnte:
Es gab mehrere Busse, die von Wuchang aus über den Fluss fuhren, bis nach Hankou dauerte das mitunter zwei Stunden in vollen Bussen, stehend, zwischen vielen anderen Menschen. Es gab Busse, die fuhren über die Große (Alte) Brücke, über Hanyang und den Schildkrötenhügel, am Guqintai vorbei, es gab welche, die Bogen vorher ab und fuhren nach „unten“ über die Spannseilbrücke. Es gab O-Busse und normale Busse, über die Spannseilbrücke fuhren auch zweistöckige. Dann konnte man auch mit der Fähre über den Fluss fahren – es dauerte auch recht lange, aber der Wind verwehte einem die Haare und eigentlich ging es schneller vorbei als eine Busfahrt. Roller und Radfahrer fuhren auf die Fähre, man konnte drinnen sitzen oder am Reling stehen. Die Überfahrt kostete genausowenig wie eine Busfahrt.
Nicht alle Taxis fuhren über die Brücke, 2009 prägte ich mir ein, dass es von den Autokennzeichen abhing: gewisse Nummern (gerade/ungerade) durften an gewissen Tagen über die Brücke – auf der Brücke war immer Stau. Man konnte auch zu Fuß über die Brücke gehen, was aber ein wenig unheimlich war, da die Brücke so lang und groß war: unten fuhren die Züge, oben waren die tausend Autos, in den Wachtürmen standen Polizisten und unter einem fuhren die Schiffe durch. Mit dem Zug überquerte man die Brücke, wenn man von Wuchang losfuhr in den Norden: wenn man aus dem Zugfenster sah, konnte man noch die Schwellen sehen und darunter: den Fluss, ein bisschen wie fliegen.

Es gab auch einen Tunnel unter dem Fluß, aber da fuhren die Taxifahrer nur ausnahmsweise: die Einfahrt war beschränkt, es staute sich bei meinen Fahrten gottseidank nicht, aber lieber fuhren alle oben rum. Unten fuhr man einen ganzen Kilometer unter dem Fluss durch.
Kam man in Hankou am Bahnhof an und musste nach Wuchang und wollte sich die Mühe mit den zweistündigen Bussen ersparen, so nahm man ein Taxi und wusste doch nicht, was einen erwartete: wurde es die erste, die zweite Brücke oder gar der Tunnel?
Ich erschrecke mich über den Tagebucheintrag von 2010, Juli, dass ich diese Stadt nicht vermissen werde. Vielleicht war ich müde von den Menschen, die mich angeschaut und angesprochen haben – nein, angesprochen weniger, sondern hinter meinem Rücken über mich gesprochen, immer drehte ich mich um, konnte es nicht ignorieren, weil es so neu für mich war. Ich fühlte mich ohnehin unwohl in meiner Haut, hatte oft Kopfschmerzen, nahm zu, fühlte mich so fehl am Platz und unnütz, eine Situation, in der ich nicht gerne angesehen werde und dann war ich so sichtbar. Vielleicht war ich auch müde von all den Staus, den dichten Bussen, den kaputten Waschmaschinen im Studentenwohnheim, dem ständigen Umhergehen, der auslaufenden Zeit. Vielleicht von den paar Männern, die mir nachgestellt haben, ein Studienkollege meiner Uni, eine Zufallsbekanntschaft vom Bus: beide waren anfangs nett, bis sie offen mit mir geredet haben und dann ist es schief gegangen. Dann hatte ich Angst vor meiner Tür.
Angenehmer war da der mexikanische Studienkollege, mit dem ich einmal nach Hankou im Bus fuhr, während er die gesamte Strecke über den Fluss über das Leben philosophierte, dann spazierten wir durch die kleinen autofreien Gassen und aßen in einem Restaurant Wuchang-Fisch. Am nächsten Tag kannte er mich schon nicht mehr, grüßte nicht mehr, nur manchmal, wenn ich ihn ausdrücklich grüßte, schien er mich überhaupt zu sehen. Ich habe die anderen Studierenden gefragt, die mich beruhigten, es wäre ihnen auch so gegangen, er erkannte Leute einfach nicht wieder.

Wuhan IV (April 2020, Wien)
Anfang April hat mich die Zeit überholt, ich muss mir selbst die Maßstäbe setzen. In den Vlogs aus Wuhan tragen viele die Masken irgendwie, halten keinen Abstand, greifen Dinge an. Ich kann nicht mehr alles, was ich im Internet sehe, einfach auf- und übernehmen, ich habe die Zeit überholt. Ich muss selbst herausfinden, was gefährlich ist und nicht.
Einige Tage lang konnte ich keine Nachrichten aus Wuhan mehr lesen, weil es sich überall anders überschlagen hat. Jetzt gewöhne ich mich an die Nachrichten, die nicht mehr nur aus Wuhan kommen – und ich kann ein, zweimal am Tag nachsehen, was die Leute in Wuhan so tun – falsch: was sie posten, was sie tun. Viele holen sich Getränke oder das erste Mal Frühstück draußen. Die meisten machen schöne Fotos vor Gebäuden und Bäumen, dazu nehmen sie die Masken ab oder hängen sie sich unters Kinn wie die Wiener, sobald sie aus dem Supermarkt kommen.

Wuhan V (April 2020, Wien)
In den letzten Monaten habe ich soviele Videos und Fotos von Wuhan gesehen, dass meine eigene Erinnerung davon überholt ist. Ich zweifle an, jemals dort gewesen zu sein. Vielleicht erkenne ich das Huanghelou nur, weil ich es so oft auf Fotos gesehen habe. Jemand dreht vor ein paar Tagen – nachdem der Lockdown in Wuhan beendet ist – einen kleinen Vlog, geht dabei auf die Alte, Große Yangtze-Brücke, filmt die Ufer und geht zurück, aufs Huanghelou zu. Ich seh die Fähranlegestelle, der Vlogger meint, von allen Arten, in der Stadt zu reisen, würde er die Fähre am meisten lieben, man könne am Reling stehen und die Flussluft atmen. Die Fähre hat sich in meiner falschen Erinnerung auch immer als die schönste Art, den Fluss zu überqueren, angefühlt. Am Reling stehen, die rote, untergehende Sonne anstarren, die Wellen.
Ich erschrecke, als die Ufer von Hankou und Hanyang ins Bild kommen: auf den Fotos muss ich es ignoriert haben, am Video sehe ich es deutlich: die Häuser, die damals die größten waren, die Landmarks, sind jetzt von zig viel höheren Häusern überbaut. Am ersten Abend in Wuhan stand ich am Ufer von Wuchang, links der Brücke und blickte auf die neuen leuchtenden Hochhäuser in Hanyang. Jetzt sind dort dutzende und ich kann nicht mehr erkennen, was ich damals angestarrt haben muss. Nur der Teil zwischen Fluss und Huanghelou ist niedrig und alt, wird vielleicht als solch alter Stadtteil geschützt. Damals habe ich ignoriert, wie viele Bäume es hier gibt – der Zug von Wuchang, den ich fast wöchentlich nahm, fuhr mitten durch und ich sah die Bäume nicht. Jetzt sitze ich in der Wohnung, viel zu viel und sehe, wie grün der Teil von Wuchang wirklich ist, immer noch. Es ist Frühling.